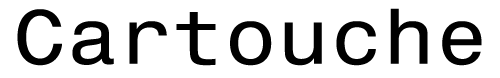In seinem Text „Alles Populäre ist falsch“, der am 6. August in der TAZ erschien, rechnet der Berliner DJ STEFAN GOLDMANN mit der digitalen Revolution ab. Durch die nahezu kostenlose Produktion habe sich ein Vertriebsmodell entwickelt, dass so „ineffizient“ sei, wie keines zuvor. Der Grund: Gegen das Überangebot an Musik habe die menschliche Aufmerksamkeit keine Chance. Da die mentale „Regalfläche“ knapp sei, könne man sich lediglich durch einen Bruchteil der im Netz kursierenden Musik arbeiten. Während die Majors davon profitierten, dass man sich in der Not auf einige Superstars konzentriert, versinke das Mittelfeld im „Rauschen des Überangebots“. Mit Mittelfeld meint GOLDMANN die Indies, die angesichts des Konkurrenzdrucks und des geringen Werbebudgets nicht ausreichend auf ihre Musik aufmerksam machen könnten. Die Folge: Sie müssten dicht machen, da sie kein Geld mehr verdienen.
Eine weitere negative Folge sei die zunehmende Entprofessionalisierung der Musik. Da sich viele MusikerInnen wegen ausbleibender Einnahmen aus den Plattenverkäufen kaum noch professionelle Hilfe für den Ton, die Produktion und die Gestaltung leisten könnten, müssten sie sich selbst um diese Aufgaben kümmern, weswegen nicht mehr genug Zeit für die Musik bliebe. Die Qualität der Musik würde dadurch in Mitleidenschaft gezogen.
Das Web 2.0 als Chance
GOLDMANNS Argumentation hinkt an mehreren Stellen. Sei es, dass er die Filterfunktion von Blogs verkennt oder die Fähigkeit der MusikhörerInnen, mit dem reichen Musikangebot des Web 2.0 zurecht gekommen.
Am Gravierendsten ist jedoch seine Fehleinschätzung der digitalen Revolution. Diese hat viele positive Effekte mit sich gebracht: Da wäre zum einen die Demokratisierung des Musikgeschäfts. Nicht Plattenfirmen und Musikmagazine bestimmen mehr, wer gehört wird und wer nicht, sondern die zahllosen Musikblogs und, was noch viel wichtiger sind, die HörerInnen selbst. Gefällt ihnen ein Album, verlinken sie es auf Facebook und geben den Interpreten Geld, damit diese weitermachen können.
Zum anderen hat das Internet die Partizipation am Musikmarkt deutlich vereinfacht. Digitale Aufnahmeprogramme und soziale Netzwerke ermöglichen es, Musik nahezu kostenlose zu produzieren und zu vertreiben. Entsprechend scheint die Zahl an Selbstveröffentlichungen seit Beginn des digitalen Zeitalters deutlich gestiegen zu sein. Das Resultat aus dieser Entwicklung ist eine Unabhängigkeit, die den KünstlerInnen des Web 2.0 die Freiheit ermöglicht, die Musik aufzunehmen, die ihnen gefällt. Ob sich das Produkt verkauft oder nicht, ist Nebensache.
Qualität? Ja, bitte!
Die Musikqualität hat ebenfalls nicht nachgelassen. Zumal sowieso fraglich ist, was GOLDMANN unter Qualität versteht: Geht es ihm dabei um den Sound oder um die Musik an sich? Gute Songs werden jedenfalls nach wie vor geschrieben. Und das nicht zu knapp. Zudem gilt noch immer: Ist das Produkt interessant, lässt es sich verkaufen. Daran hat sich auch im digitalen Zeitalter nichts geändert. Im Gegenteil scheint die Qualität dank des „Überangebots“ endlich wieder das wichtigste Kriterium zum Erfolg zu sein. Genau darauf sollte das Augenmerk gelegt werden.
Links: Stefan Goldmann – „Musikmarkt im Netz: Alles Populäre ist falsch“