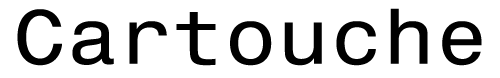Kollektives Vergessen
Kultur ist nicht was im Museum steht oder in der Oper aufgeführt wird, Kultur ist was wir daraus machen. Viele von uns haben sich längst von der Idee einer festen Leitkultur verabschiedet und bauen sich mit Filmen, Buttons, Kleidung, Tätowierungen, Büchern und dem eigenen Musikgeschmack einen auf den Leib geschneiderten Bedeutungskosmos auf. Oft vergessen wir dabei um die Geschichte oder ehemalige Bedeutung von Gegenständen, Handlungs- und Verhaltensweisen oder aber beziehen uns ganz bewusst darauf – oft Jahrzehnte später in einem neuen, vielfach kommerziellen Kontext. Aspekte globaler Kulturen leben demnach in ihrer/unserer Praxis und werden dabei fortlaufend umgedeutet. Das Stichwort lautet: Neukontextualisierung. Denn die Dinge sind nicht, was sie sind. Sie sind, was wir denken was sie sind und was wir mit ihnen anstellen.
„…das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi”
So viel Ehrlichkeit vorweg: fand ich diese im Internet dokumen- tierte Einschreibung im öffentlichen Raum anfangs noch originell, so wurde dieser Eindruck schnell wieder revidiert. Stöbert man nämlich im kollektiven Gedächtnis des Internets, stellt sich diese Aussage als viel und leider oft auch falsch zitierte Plattitüde heraus. Neben oben angeführtem Vergleich tauchen noch Metaphern auf wie „Das Leben ist ein Zeichnen ohne Radiergummi” oder „Das Leben ist Zeichnen ohne Radiergummi”. Wahlweise werden der österreichische Maler und Schriftsteller OSKAR KOKOSHKA oder ein gewisser KEES SNYDER als Urheber angeführt. Dabei scheuen die Zitierenden weder vor der hochintellektuellen Ausformulierung ihrer individuellen Deutungsmuster, noch schrecken sie vor der Instrumentalisierung geliehenen Gedankenguts zur Bewerbung der gnostischen Lehre bzw. zur Aufklärung gegen Schwangerschaftsabbrüche zurück. Zwar kenne ich den genauen Entstehungskontext dieser Aussage nicht, die den Autoren oftmals nicht anführende Reproduktion im Internet und auf bedruckten Radiergummis im Schreibwarenladen jedoch macht den Eindruck, als habe dieser Satz ein „Eigenleben” entwickelt. Losgelöst von seinem ursprünglichen Kontext und der hochkommunikativen, öffentlichen Dynamik einer transformierenden Gesellschaft unterworfen, wird der Satz zum geflügelten Wort.
Dieses Phänomen ist keineswegs einzigartig, sondern vollzieht sich seit jeher mal auffälliger und mal unauffälliger. Eine begünstigende und öffentlich einsehbare Plattform für derartige Umdeutungen von Sinnzusammenhängen und Konnotationen ist heute das Internet. Dieses globale Netzwerk macht es nicht nur möglich in höherer Geschwindigkeit zu kommunizieren, sondern auch immer wieder kulturelle Grenzen hinter sich zu lassen. Musiker und Designer, Architekten und Schriftsteller, Musik- und Modefans – viele zitieren heute und gehen dabei sehr selektiv vor. In Anlehnung an menschliches Schaffen, tradierte Mythen, Bauwerke, Lieder und Geschichten, werden Dinge im Jetzt erschaffen, welche selbst in detailgetreuer Rekonstruktion nie wieder an ein vermeintliches Original oder ein historisch verzerrtes Bild von Zeitgeist heranreichen.
Einschreibung im urbanen Raum
Sieht man sich die Website des aus- gewählten Beispiels an, stößt man auf eine ganze Reihe symbolischer Einschreibungen in Berlin. Diese modernen Palimpseste gehen auf eine antike Kulturtechnik der Wiederbeschreibung zurück. Vormals auf ausgewaschenen oder abgekratzten Manuskriptseiten ausgeübt, hat diese reproduktive Technik im Laufe der kontinuierlichen Anwendung selbst eine De- und Neukontextualisierung erfahren und sich in den öffentlichen Raum verschoben. Autoren treten bei diesen modernen Beispielen in den Hintergrund, vielfach wird einfach zitiert. Auch sind die Einschreibungen vielerorts nicht lange erhalten, da sie entweder entfernt oder aber von den Nächsten verdeckt werden.
Dann ist da der selbst- und kontextreferentielle Inhalt des Satzes: ein Palimpsest im öffentlichen Raum, in dem es potentiell jederzeit „radiert” werden kann, reflektiert seine eigene „gezeichnete” Machart. Inhaltlich eine Unumkehrbarkeit postulierend, ist die Einschreibung in ihrer Form, ihrer kontextuellen Gestalt und als Produkt eines Lebens doch so auflösbar und dabei in einer Differenz wieder rekonstruierbar in einem neuen raumzeitlichen Kontext. In Kombination mit noch einem anderen Sachverhalt führt die Beobachtung dieses urbanen Intertextes zu einer interessanten Vermutung.
Im wissenschaftlichen Kontext der Medizin bezeichnet der Terminus Palimpsest das Phänomen des Filmrisses, also der Erinnerungslücke nach alkoholischem Rauschzustand. In beiden Verwendungskontexten konstituiert sich demnach ein festes Moment in der Bedeutung dieses Wortes: das Löschen. Es ist diese Beschreibung einer Amnesie, die in der angeführten Darlegung zu der Frage führt, wie es um das Vergessen beim kulturellen Gedächtnis steht. Wenn kulturelle Gedächtnisse durch gemeinsame Einschreibungen und damit auch Palimpseste konstruiert bzw. erhalten oder modifiziert werden, diese Einschreibungen selbst – zumindest in ihrer kontextgebundenen Form – aber vergänglich sind, besteht dann die Möglichkeit der kulturellen Amnesie?
Ein Exkurs in die Kulturwissenschaften
Folgt man den Ausführungen KARL H.HÖRNINGS und JULIA REUTERS, ist Kultur als ein dynamischer Prozess zu begreifen. Der praxis-theoretische Ansatz der Cultural Studies lässt das noch von GEERTZ postulierte, symbolisch-abstrakte selbstgesponnene Bedeutungsnetz hinter sich und untersucht den Begriff jenseits normativer Dispositionen in seiner pragmatischen Dimension. Die „Doing Culture” manifestiert sich abseits einer theoretischen Kompetenz in einer alltäglichen Performanz, aufrecht erhalten von einem Kultur schaffenden Menschen. Führt man sich hier vor Augen, dass das „Kulturwesen” Mensch nicht nur kulturelle Nachlässe verwaltet und modifiziert, sondern auch immer noch neue generiert, dann stellt sich einem die Frage nach der Verfassung des kulturellen Gedächtnisses. Trotz inkorporierter und externer technischer Speichermedien und gerade im Angesicht einer überaus schnelllebigen, globalisierten Populärkultur, stößt der Mensch an die Grenzen der Memoration.
Allerdings: im Gegensatz zur konkreten Form einer einzelnen kulturellen Einschreibung und Konstruktion, die im Grunde immer von Individuen abhängig ist, lebt die Kultur über beide weit hinaus. Sie mag sich in einer Vielzahl solcher Einzelakte begründen, ist aber als kollektives Orientierungsprogramm schließlich über sie erhaben. Nichtsdestotrotz lässt sich bereits jetzt beobachten, wie der Zugriff auf Traditionen und die gemeinschaftliche Ko-Memoration in Kulturräumen gerade in säkularisierten Gesellschaften wie der unseren immer selektiver werden. Soziale Dispositionen erfahren mit dem Prozess der Individualisierung und der Erschaffung eines zunächst klassenlosen Raumes namens Internet eine viel größere Dynamik. Galt früher als Maxime eine schöngeistige Hochkultur, ein ererbtes Repertoire ehemals führender Gesellschaftsschichten, dessen sich dann die Bildungsbürger-Schicht annahm und welches noch Horkheimer und Adorno gegen die „verdummende Kulturindustrie” ermahnend abzugrenzen suchten, dominiert heute die massenmediale Transformations-Maschine Pop.
Subversiv und hungrig, dekontextualisierend und reproduzierend, bedient sich die Popkultur wo sie nur kann. Angeheizt von der Werbe-, der Musik-, der Literatur-, der Kunst-, der Film- und der Modeindustrie und beschleunigt im delokalisierten Ort des Internet, vermengen sich in ihr die Narrative, Texte und Traditionen aus unterschiedlichen Kulturgebilden. Dabei werden nicht nur Bestandteile weltweiter Leit- und Subkulturen transformiert, sondern auch Errungenschaften der Popkultur selbst. Es wird geremixt.
Kultur als Selbstbedienungsladen
Wo der eine nun eine erfolgsversprechende Marktlücke wittert, bringen andere Kritik an. So kommt auch JONAS WOLF in seiner Bachelorarbeit „Die Kunst der Kontemplation – Wider unser Kommunikation” von 2011 in einem Kapitel auf den Remix zu sprechen. Aufbauend auf der eingehenden Analyse einer überkommunizierenden Gesellschaft und der FLUSSERSCHEN Unterscheidung zweier Grundpfeiler der Kommunikation Dialog und Diskurs, attestiert er unserer Leistungsgesellschaft eine diskursive Tendenz, die nach der Gliederung MICHEL MANFÉS einen Informationsmangel auf breiter Ebene bedeute. Dialoge kämen, einem zeitlichen- und einem Leistungsdiktat geschuldet, nicht mehr zu Stande und die Kommunikation offenbare ihre problematische Komplexität. JEAN BAUDRILLARD zitierend folgt er so „Die Zeit der Re-Produktion […] ist die Zeit des Codes, der Streuung und der totalen Austauschbarkeit der Elemente” (Baudrillard, 1978, S. 21 in Wolf, 2011, S. 33 f.). Lässt dieses Zitat nicht schon genug Rückschlüsse auf die Beschaffenheit unseres kulturellen Repertoires und unseren diesbezüglichen Umgang damit zu, lässt sich noch eine weitere Bemerkung rezitieren, diesmal von WILLIAM GIBSON, der polemisch bemerkt „Today’s audience isn’t listening at all – it’s participating. Indeed, audience is an antique a term as record, the one archaically passive, the other archaically physical. The record, not the remix, is the anormaly today” (Gibson, 2005, in Wolf, 2011, S. 34). Es ist diese reproduzierende Partizipation beziehungsweise eingekaufte Reproduktion der breiten Masse, die die von uns gelebte Popkultur so sehr auszeichnet – die einer symbolischen Kompetenz entbundene Performativität. Dabei ist der Remix keinesfalls ein rein musikalisches Phänomen. Er ist viel mehr das Transformations-Instrument, die Möglichkeit und das Diktat der Bricolage. Der spätmoderne, kulturschaffende und in einer Differenz immer reproduzierende Mensch ist ein Bastler und die „Doing Culture” ein Selbstläufer.
Amnesie und Umschreibung
Es bleiben nun zwei offene Fragen noch zu beantworten: Ist erstens ein kollektives Orientierungsprogramm revidierbar und besteht zweitens die Möglichkeit der kulturellen Amnesie? Ich denke ja und behaupte weiterhin, dass diese Prozesse sich gegenseitig bedingen. Natürlich können kulturell tradierte Verhaltensmuster, Kulturtechniken und über Generationen hinweg kommuniziertes Wissen nicht einfach wegradiert werden, aber sie können zerstaltet werden. In einer hochgradig dynamischen Progression, getrieben von milliardenschweren Kulturindustrien und einem von ihr inspirierten individualistischem Heer, werden die zahlreichen Facetten und Ausprägungen von Kulturen in kommunikativer Aneignung zu Collagen mit neuer Bedeutungsaufladung. Es wird nun in sofern nicht vergessen, als dass einfach überschrieben wird oder, um es in Anlehnung an die medizinische Definition des Palimpsestes auszudrücken: der hochkommunikative, translokale Vollrausch, verschleiert uns das kulturelle Gedächtnis.
—
GUENTHER LAUSE ist ein Kind seiner Zeit. In die Welt geworfen, versucht er sich an Orientierung und haust gedanklich in seiner großstädtischen Sternwarte. Spiegel einer Persönlichkeit und programmiertes Kultursubjekt, ermüdet er sich und andere zunehmend – über Betrachtungen bedeutungsvoller Schrotthaufen. GUENTHER LAUSE lebt.
Quellenverweise:
http://www.notesofberlin.com/search?updated-max=2012-01-18T09:00:00%2B01:00&max-results=5
Baudrillard, Jean: Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen, Berlin, 1978
Gibson, William: Wired Magazine, July 2005
Hörning, Karl H. & Reuter, Julia: Doing Culture – Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis, Bielefeld, 2004
Wolf, Jonas: Die Kunst der Kommunikation – Wider unser Kommunikation, Hamburg, 2011