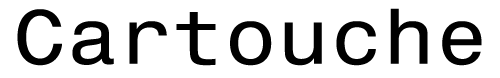Die digitale Revolution hat einen neuen Typus Künstler hervorgebracht: Er verschenkt seine Musik und nutzt erfolgreich die neuen Möglichkeit der Selfmade-Produktion und des Eigenvertriebs. Einer von ihnen ist der Chillwaver Chaz Bundick alias Toro y Moi, der für sein Debütalbum „Causers of this“ dies- und jenseits des Atlantiks viel gefeiert wurde. Bundick nahm seine ersten EPs und Alben in Eigenregie am Laptop auf und verbreitete sie anschließend über Blogs kostenlos im Internet. Wie er im Gespräch mit cartouche. erklärt, gehöre das inzwischen zum Pflichtprogramm, wolle man es heute noch zu etwas bringen.
Chaz, die digitale Revolution hat das Musikgeschäft gründlich auf den Kopf gestellt. Plattenfirmen und Musikmagazine scheinen angesichts der neuen Möglichkeiten des Eigenvertriebs und der kostenlosen PR-Arbeit der unzähligen Fanblogs überflüssig geworden zu sein. Inwiefern hat dir das Internet bei deiner Arbeit geholfen?
Chaz Bundick: Ich habe das Internet genutzt, um meine Musik kostenlos zu verbreiten. Hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt, wäre ich längst nicht so erfolgreich.
Moment mal, du hast deine Musik kostenlos ins Netz gestellt?
Selbstverständlich! Kennst du noch Jemanden, der Musik legal erwirbt? Ich nicht. Warum die eigenen Aufnahmen also nicht gleich verschenken? Nicht einmal Musiker geben noch Geld für Musik aus. Künstler, die das Gegenteil behaupten, lügen oder wissen ganz einfach nicht, wie man Mediafire und Rapidshare benutzt.
Du hast also nichts gegen Musikblogs, die einfach nur die Rapidshare-Links von geleakten Alben verbreiten?
Ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Das sind meine Lieblingsblogs! Einen Großteil der Musik, die ich besitze, habe ich illegal aus dem Netz geladen. Genauso habe ich kein Problem damit, dass meine Aufnahmen im Netz kursieren.
Kannst du trotzdem von deiner Musik leben?
Klar! Ich verdiene mein Geld mit Konzerten.
Du hast deine Musik anfangs also kostenlos und ohne die Hilfe eines Labels vertrieben. Wo hast du noch auf klassische Strukturen verzichtet?
Ich habe Tonstudios gemieden. Meine Alben und EPs habe ich bei mir zuhause in South Carolina auf meinem Laptop produziert. Hierfür nutzte ich die Software Fruity Loops und ein Kassettenaufnahmegerät.
Du schlüpfst also in die Rolle des Produzenten. Welche Talente muss ein Musiker heutzutage noch besitzen?
Wenn du es heute zu was bringen willst, musst du dich auch mit Management auskennen. Da das Internet die Kommunikation erheblich erleichtert hat, ist das gar nicht mehr so schwer. Eins ist klar: Es reicht längst nicht mehr aus, einfach nur gute Musik zu machen.
Würdest du sagen, dass das Musikgeschäft durch das Internet demokratischer und partizipativer geworden ist?
Es ist auf jeden fall einfacher geworden, sein eigenes Ding zu machen. Trotzdem kann man bei Fülle an Musik schnell den Überblick verlieren. Ich persönlich finde kaum noch die Zeit, mich richtig auf ein Album einzulassen.
Links: toro y moi / blackbird blackbird / millionyoung
(Foto: BRYAN BUSH)